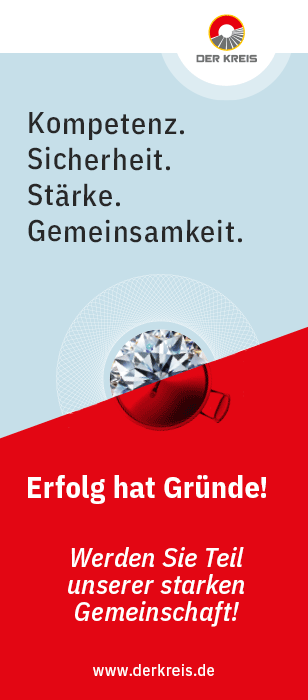Ein Gespräch mit Dr. Andreas Hettich
„Erfolg ist ein Gefühl“

Dr. Andreas Hettich ist mehrfacher Familienunternehmer – nicht nur als Hauptgesellschafter der Hettich-Unternehmensgruppe, des größten deutschen Beschlagsherstellers. Seiner Familie gehören mittelständische Unternehmen wie Halemeier oder Ewikon. Über die Dr. Hettich Beteiligungen investiert Andreas Hettich in Portfolios von Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaften, die nachhaltige Ziele unterstützen und in Unternehmen, „die unsere Welt lebenswerter machen und Substanz schaffen“.
Aus der operativen Führung der Hettich-Gruppe hat der Unternehmer sich vor fünf Jahren zurückgezogen. Im INSIDE-Gespräch erklärt er unter anderem, warum das der richtige Schritt war und wie gute Unternehmensführung heute aussehen kann.
INSIDE: Herr Dr. Hettich, Sie sind nun schon fünf Jahre nicht mehr im operativen Geschäft Ihrer Unternehmensgruppe aktiv. Mit 50 sind Sie in den Beirat gewechselt. War das aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung?
Dr. Andreas Hettich: Die kurze Antwort ist: Ja. Für die etwas längere muss ich nochmals erklären, wieso ich diese Entscheidung damals getroffen habe. Im Frühjahr 2019 habe ich mal drei Monate meines Kalenders danach durchforstet, womit ich meine Zeit verbringe. Ich habe festgestellt, dass ich bei Kundenbesuchen und auch anderen Dingen nicht unbedingt in meiner Funktion als Geschäftsführer gefragt war, sondern als Andreas Hettich. Bei internen, organisatorischen Themen habe ich festgestellt: Wirklich gern mache ich die eigentlich nicht. Zum anderen ist es ein Langfristprojekt, das Unternehmen in die fünfte Generation zu bringen. Das macht man nicht nur nebenbei. Da meine Frau erkrankt war, hatte ich zudem den Wunsch, sie stärker zu unterstützen. Ausschlaggebend war dann aber letztendlich, dass wir ein Team hatten, dem ich zutraute, das Unternehmen auch prima ohne mich zu steuern.
Mit der Umsetzung ging es dann relativ schnell.
Ich bin ein Fan davon, Dinge, die ich im Hinterkopf habe, auch auszuprobieren. Wenn man so einen Schritt mit 50 macht, hat man gute Chancen, noch zurückzukommen. Mit 70 wäre das weniger möglich.
Auch dafür gibt es Beispiele.
Die selten gut sind.
Das damalige Führungsteam hat sich verändert. Inzwischen wird dieses Modell, Verantwortung abzugeben, im ganzen Unternehmen angewandt. Hettich kommuniziert recht offen diese neue „Many-to-many“-Managementkultur. Woher kam der Antrieb dafür?
Es ist eine gemeinsame Entwicklung, die eigentlich schon begonnen hat, als ich noch operativ tätig war. Es waren aufregende fünf Jahre, angefangen bei Corona. Dann kam der Brand in Berlin, ein Nachfragehoch, das Nachfragetief. Und letztes Jahr ist auch noch unser Lager in Indien abgebrannt. All diese Dinge hat das Team gut gemeistert. Ich sehe die Many-to-many-Organisation als große Stärke, weil sie durch die Breite viel mehr Stabilität und Vertrauen gibt. Wir sind nicht mehr von einzelnen Personen abhängig.
Woher kommt das Konzept? Wurde es selbst entwickelt?
Jana Schönfeld und ich haben uns diese Frage selbst schon gestellt. Es hat sich tatsächlich über die Jahre einfach entwickelt. Wir haben viel gelesen und Dinge ausprobiert. Manchmal ist auch einfach der Zufall dazugekommen. Unser erstes selbst organisiertes Team war die Steuerabteilung. Dort war die Führungskraft erkrankt und hat gekündigt. Wir brauchten von heute auf morgen eine Lösung und haben die Frage gestellt, ob das Team sich zutraut, sich in der Übergangszeit selbst zu organisieren. Sie haben das angenommen und sehr strukturiert umgesetzt, haben sich Regeln gegeben wie ein Vier-Augen-Prinzip. Das hat so gut funktioniert, dass wir es zur dauerhaften Lösung gemacht haben. Wir hatten am Ende zwei Personen weniger, und die Menschen waren produktiver und zufriedener.
Das war nur der Anfang.
Seither haben wir Gelegenheiten genutzt, wenn es Nachfolgen zu regeln gab. Es funktioniert nicht überall, aber häufig.
Wenn man in eine hierarchisch organisierte Abteilung eingreift, die funktioniert, kann das auch zu Unmut führen.
Darum beruht es auch auf Freiwilligkeit. Die Menschen müssen es wollen. Nicht jeder will es. Noch sind wir in einer Übergangsphase. Es gibt auch keinen Zeitplan. Aber wir kommunizieren seit diesem Jahr doch stärker, dass es von der Ausnahme nun in den Normalzustand geht.
Hat es Sie in den letzten Jahren, als es im Markt den Bach runterging, nicht gejuckt, sich stärker einzumischen? Oder sind Sie froh, wenn Sie mit solchen Problemen nicht direkt zu tun haben?
Tatsächlich bin ich ganz froh, mich nicht täglich so intensiv damit befassen zu müssen. Nach wie vor fühle ich mich gut damit. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es deutlich besser würde, wenn ich da jetzt reinspringen würde.
Welches Thema wird bei der Unternehmensführung aus Ihrer Sicht am meisten unterschätzt?
Menschen. Das Wichtigste sind die Menschen und der Umgang miteinander. Spannend wird das zum Beispiel beim Thema Homeoffice. Auch wir haben eine Regelung dazu, die im Wesentlichen heißt: Wir haben keine Regelung.
Es muss halt funktionieren.
Genau. Bei uns können die Menschen es so wählen, wie es passt. Es muss zu den Teams passen und es muss zum Zusammenwirken passen. Wir kontrollieren keine Anwesenheiten oder setzen Programme ein, die checken wollen, wie viel die Tastatur bedient wird oder ähnlichen Quatsch. Es geht um Vertrauen in die Menschen. Aus meiner Sicht ist hier der größte Hebel. Systeme, Technik und so weiter braucht man auch, und sie müssen gut sein. Doch den Unterschied macht das Zusammenwirken der Menschen. Damit wird sich in der Regel zu wenig und häufig auch zu spät beschäftigt.
Bei der AMK-Vereinsmitgliederversammlung im März durften wir einen Vortrag hören zum Thema „Belonging“, das die Referentin als den wichtigsten Faktor moderner Führungskompetenz eingeordnet hat – und als Produktivitätsbooster. Dieser Vortrag hat stark polarisiert.
Das erlebe ich auch. Der Blick darauf ist doch sehr unterschiedlich. Und nach wie vor wird viel über Bewerber geschimpft, die als erstes nach Homeoffice und Work-Life-Balance fragen würden. Solche Fragen finde ich zum einen nicht per se unanständig, und zum anderen ist es auch gut, wenn man darüber spricht. So kann man gegenseitig Erwartungen miteinander in Einklang bringen.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das allerwichtigste Thema momentan für Unternehmer?
Man nennt das so schön Resilienz, also eine gute Stabilität zu haben, nicht nur ein Standbein. Hier ist übrigens unsere Industrie extrem beständig. Die Disruption hat ein im Vergleich zu anderen Industrien gemächliches, überschaubares Tempo, auf das man sich gut einstellen kann. Zu der breiten Aufstellung gehört auch eine hohe Internationalität.
Sind Sie beim Gedanken an die Zukunft eher zuversichtlich oder eher sorgenvoll?
Beides. Viele Dinge entwickeln sich sehr gut, auch global. Die absolute Armut hat stark abgenommen, die Gesundheitsversorgung ist besser geworden, die Kindersterblichkeit zurückgegangen. Etwas sorgenvoll schaue ich eher auf die westliche Welt, auf die Entwicklungen in den USA natürlich, auf die Entwicklung der westlichen Demokratien. Im Großen und Ganzen aber geht es uns gut. Doch wir haben so einen Anstieg an Empörung. Diese durchgängige Empörung über jeden und alles macht mir etwas Sorge, der fehlende Dialog und dass kaum darauf geschaut wird, was denn funktioniert. Wir trauen den Menschen nichts mehr zu, und ohne Vertrauen muss man halt alles bis ins Kleinste regeln und kontrollieren.
Würde es denn auch anders gehen? Läuft es von selbst, wenn man den Leuten vertraut?
Es braucht schon einen Rahmen und Regeln, doch wir versuchen hier, jede Ausnahme zu regeln. Wir müssen wieder lernen es auszuhalten, dass ein Teil der Bevölkerung die Systeme ausnutzt. Solche Menschen nutzen es sowieso aus.
Dadurch fühlen sich wiederum andere ungerecht behandelt.
Gerechtigkeit ist einer der schwierigsten Begriffe. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es fühlt sich immer jemand ungerecht behandelt. Heute belasten wir 100 Prozent der Bevölkerung, um etwas abzufischen, das vielleicht 2 Prozent verursachen könnten. Und das mit Regeln, die diese 2 Prozent trotzdem nicht erreichen. Überspitzt gesagt, wird für jeden Einzelfall ein neues Gesetz entworfen. Man muss diesen Einzelfall aushalten und einen Einzelfall auch als Einzelfall behandeln.
Welche Auswirkungen könnten die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen auf Ihr Unternehmen haben?
Die größten Sorgen mache ich mir da im Moment auch in Bezug auf Europa und die USA. Bei den USA weiß man gar nicht, wohin es geht. Und hier zieht sich die Schlinge der Regulatorik immer enger. Wir engagieren uns sehr stark, um zu verhindern, dass Europa irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Ein Beispiel: der CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Wenn umgesetzt wird, was zurzeit geplant ist, müssten wir hier in Deutschland mit 30 bis 50 Prozent teurerem Stahl arbeiten, egal, ob er lokal produziert oder importiert ist. Außereuropäische Hersteller könnten ihre Produkte aber ohne diesen Aufschlag nach Europa liefern. Dann wären wir nicht mehr wettbewerbsfähig.
Nehmen Sie den Staat, auch die EU hauptsächlich als Hindernis wahr? Es kommt ja oft die Forderung nach staatlicher Unterstützung auf. Wäre die Unterstützung wohl, dass weniger Steine in den Weg gelegt werden?
Als Unterstützung würde ich es auffassen, dass man wettbewerbsfähige Bedingungen schafft und weniger Hindernisse, ja. Ich habe allerdings in meinem ganzen unternehmerischen Leben noch keine Standortentscheidung aufgrund von Steuersätzen getroffen. Die Forderung nach Steuersenkungen halte ich tendenziell, solange wir uns in einem vernünftigen Rahmen bewegen, für völlig überschätzt. Andere Umfeld-Themen können wesentlich stärker einwirken. Wir haben nach wie vor in Deutschland, gerade in der Produktion, die am besten ausgebildeten Mitarbeiter. Das duale System ist einfach ein echter Schatz. Überhaupt ist unser Bildungssystem relativ gut, auch wenn wir viel darüber schimpfen. Wir haben ein ausgeglichenes Klima, was eigentlich auch ein Standortvorteil ist. Trotz Klimawandel wird es im Verhältnis zu anderen Regionen immer noch relativ angenehm sein.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die Standort-Probleme?
Wir müssen zusehen, dass wir uns nicht selbst im Wege stehen. So viele Dinge sind politisch gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht oder nicht richtig in die Praxis übertragen.
Haben sich ihre unternehmerischen Ziele zuletzt verändert?
Nein. Unser oberstes Ziel ist das Generationenwerk. Wir wollen das Unternehmen auch zukünftig in der Familie halten und in die fünfte Generation, gern auch in die sechste und siebte Generation bringen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in einer Branche unterwegs sind, die auch morgen noch gebraucht wird. Solange Menschen Gegenstände haben, die sie verstauen wollen, brauchen sie Möbel.
Woran messen Sie Erfolg?
Auf der einen Seite ist Erfolg ein Gefühl. Man fühlt sich gut. Klar gibt es im Unternehmen die harten Zahlen: Umsatz, Ergebnis, Liquidität. Doch Erfolg ist auch das Feedback vom Markt, von Kunden und auch von Mitarbeitern. Umsatz, Ergebnis und Liquidität sind eigentlich immer nur ein Ergebnis davon.
Wenn Sie Ihre bisherige Laufbahn noch einmal neu gehen könnten, was würden Sie anders machen? Würden Sie was anders machen?
Tatsächlich habe ich den ein oder anderen Sprung im Lebenslauf. Im Nachhinein weiß ich natürlich viel mehr als vorher. Manche Dinge hätte ich mit dem Wissen von heute vielleicht nicht gemacht, was schade gewesen wäre. Ich habe sehr gern Elektrotechnik studiert und promoviert, später sagte mir aber das Umfeld nicht zu. Deshalb hatte ich auch die Erkenntnis, dass es auf den Menschen ankommt. Diesem Thema würde ich mich heute früher widmen, anstatt das Unternehmen nach Sparten und Produktgruppen zu organisieren.
Was heißt das konkret?
Man kann ein Unternehmen linksherum, rechtsherum, hoch, runter, quer schneiden und organisieren – wenn die Menschen miteinander kooperieren wollen, kommt etwas Gutes heraus. Wenn nicht, dann nicht. Dann kann ich organisieren, wie ich will. Eine andere Sache, die ich anders machen würde: längere Zeit im Ausland verbringen und einmal zwei, drei oder vier Jahre in eine andere Kultur eintauchen.