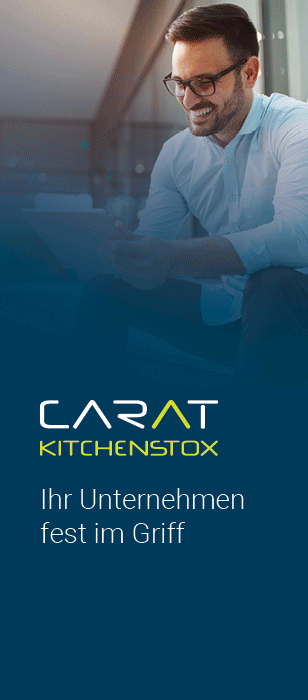Spezial Neue Ideen
Martin Auerbach
Martin Auerbach
Verunmöglichungs-Rituale der Politik schaden unserer Industrie
Verunmöglichungs-Rituale der Politik schaden unserer Industrie
Die Idee klingt simpel: wertvolle Materialien wiederverwenden, statt sie zu verbrennen. Doch in Deutschland scheitert selbst das am politischen Stillstand. Während unsere Nachbarn zeigen, wie Kreislaufwirtschaft bei Matratzen funktioniert, verzetteln sich Bundesinstitutionen in Ausnahmen und „Kann-Regelungen“. Die Industrie wartet nicht länger. Wir gehen im Matratzenverband voran – und stoßen dabei an Grenzen, die nicht technischer, sondern politischer Natur sind.
Die Idee klingt simpel: wertvolle Materialien wiederverwenden, statt sie zu verbrennen. Doch in Deutschland scheitert selbst das am politischen Stillstand. Während unsere Nachbarn zeigen, wie Kreislaufwirtschaft bei Matratzen funktioniert, verzetteln sich Bundesinstitutionen in Ausnahmen und „Kann-Regelungen“. Die Industrie wartet nicht länger. Wir gehen im Matratzenverband voran – und stoßen dabei an Grenzen, die nicht technischer, sondern politischer Natur sind.

Martin Auerbach, Geschäftsführer des Fachverbands Matratzen-Industrie, setzt sich für verbindliche Rahmenbedingungen zur Kreislaufwirtschaft ein. Er fordert von der Politik mehr Tempo und Verlässlichkeit – nicht nur bei Matratzen.
Von Martin Auerbach
Über sechs Millionen gebrauchte Matratzen entsorgen Privathaushalte in Deutschland jedes Jahr – 95 Prozent der enthaltenen Materialien werden bis dato verbrannt, das sind über 85.500 Tonnen Wertstoffe, die ungenutzt verloren gehen. Unsere Nachbarländer Belgien, Frankreich und Niederlande zeigen mit funktionierenden Systemen der Erweiterten Herstellerverantwortung für Matratzen (Extended Producer Responsibility, kurz EPR): Das muss nicht sein! Die drei Länder verfügen über funktionierende Rückwärtslogistik für Matratzen, wenden Downcycling- und Recyclingverfahren auf die so gewonnenen Materialien an und bauen ihre Kapazitäten weiter aus. Die Finanzierung erfolgt durch Gebühren, die von den Inverkehrbringern pro Matratze zu entrichten sind.
Der Aufbau eines industriegetragenen EPR-Systems für Matratzen ist die entscheidende Maßnahme, um auch in Deutschland diesen wertvollen Stoffstrom zu nutzen und zur Kreislaufwirtschaft beizutragen. Deshalb lautet der eindringliche Appell des Matratzenverbands an die neue Bundesregierung: Schaffen Sie den regulatorischen Rahmen und fördern Sie die Umsetzung eines EPR-Systems in Deutschland, damit wir in der Entwicklung nicht noch weiter hinter unsere Nachbarländer zurückfallen!
Der Fachverband Matratzen-Industrie will nicht warten, bis die Veränderungen von der Politik top-down bei den Unternehmen ankommen. Nicht wenigen Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals, weitere Hängepartien sind nicht hinnehmbar. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Branchen – und das gilt natürlich nicht nur für Matratzen – jetzt ihre Möglichkeiten nutzen, mitzugestalten und Fakten zu schaffen. Wir wollen die Prozesse beschleunigen und vor allem den Wandel so mitgestalten, dass unsere Wirtschaft gestärkt wird. Landläufig mag es das Vorurteil geben, wonach die Industrie der Haupt-Bremser für den grünen Wandel sei und sich nur dann bewege, wenn sie dazu gezwungen wird. Doch das entspricht – zumindest für unsere Branche – nicht der Realität.
Der Matratzenverband bearbeitet das Mega-Thema Transformation schon seit Jahren mit Engagement. Nach einem Positionspapier zur Matratzen-EPR 2022 und einem Real-Labor zur Getrenntsammlung und Zerlegung von Alt-Matratzen 2023 folgte Ende letzten Jahres die Gründung der Betreiber-Organisation Matratzen Recycling Deutschland (MRD, www.matratzen-recycling.de). So übernimmt der Verband gemeinsam mit zehn seiner Mitgliedsunternehmen eine Vorreiterrolle.
Um den Status quo besser einzuordnen, an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur regulatorischen Arbeit auf EU- und Bundesebene: „Nachhaltige Produkte zur Norm in Europa machen“ – mit diesem Slogan präsentierte die Europäische Kommission im Frühjahr 2022 ihre „Schlüsselmaßnahmen für kreislauffähige und nachhaltige Produkte“. Das Paket ist ein zentraler Baustein des Green Deals und das Ziel ist nicht weniger als die EU-weite Umstellung auf Kreislaufwirtschaft. Die Industrie soll von Anfang an, also ab der Entwicklung und Gestaltung neuer Produkte, verpflichtet werden, umwelt- und kreislauforientiert zu handeln.
Das alles ist heute ziemlich genau drei Jahre her, ein guter Anlass also, um zu hinterfragen, was seitdem passiert ist – oder auch nicht passiert ist – und an welchen Stellen der Prozess stockt. Werfen wir dafür noch mal einen Blick zurück auf die angepeilten Schlüsselmaßnahmen der EU: In deren Mittelpunkt steht die neue Öko-Design-Verordnung (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, kurz ESPR), die auch tatsächlich im Sommer 2024 verabschiedet wurde. Nach und nach werden jetzt für immer mehr Produktgruppen Öko-Design-Kriterien erarbeitet. Neben Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten zählen dazu auch die ressourcen- und energieeffiziente Produktion sowie verpflichtende Rezyklat-Anteile. Zudem müssen bis 2030 sektorübergreifend Digitale Produktpässe (DPP) eingeführt werden.
Mit dem Arbeitspaket von 2022 sollen weiterhin die Vernichtung unverkaufter Produkte verhindert, nachhaltige Geschäftsmodelle gefördert und die Vergabe öffentlicher Aufträge an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt werden. Ein dickes Brett also, das die EU da bohren will. Und davon verspricht sie sich und den beteiligten Stakeholdern neben der „bloßen“ Ressourcen-Schonung einige Zusatznutzen: „Möbel, Textilien und andere Produkte werden zur Widerstandsfähigkeit der EU-Wirtschaft beitragen“, so heißt es in der Veröffentlichung zur EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Den Unternehmen werden sinkende Verwaltungskosten, fairer Wettbewerb und zudem ein weltweiter Wettbewerbsvorteil in Aussicht gestellt. Verbraucher sollen ihre Kaufentscheidungen unkompliziert an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten und sich z. B. für langlebigere Konsumgüter entscheiden können. Alles vielversprechende Perspektiven, denen sich kaum einer verschließen würde – insbesondere in Zeiten, in denen die Wirtschaft unter schwacher Nachfrage und globalem Wettbewerbsdruck leidet. Aber wo stehen wir heute, drei Jahre nach den beschriebenen Absichtserklärungen?
Das Inkrafttreten der ESPR im Juli 2024 markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt, denn sie bringt den Rechtsrahmen für verpflichtende Öko-Design-Anforderungen für nahezu alle Arten von Produkten. Und das ist ein zentraler Aspekt: Nur mit soliden Rahmenbedingungen für den Wandel wird die Wirtschaft auf die Beine kommen! Die Industrie ist zwingend angewiesen auf Planungssicherheit für die erforderlichen Strategieanpassungen, aber auch für die nötigen Investitionen in neue Produkte, Fertigungsprozesse und Rückwärtslogistik. Nicht zuletzt wird auch ein erheblicher kommunikativer Aufwand mit breit angelegten Kommunikationskampagnen seitens der Politik nötig sein, um die Konsumentenseite beim Wandel mitzunehmen und zu sensibilisieren – eine Aufgabe, die kaum von der Industrie allein zu stemmen sein wird.
Jetzt Artikel freischalten:
- ✓ Zugang zu allen Artikeln auf INSIDE Wohnen
- ✓ INSIDE als E-Paper lesen
- ✓ Monatlich kündbar

Martin Auerbach, Geschäftsführer des Fachverbands Matratzen-Industrie, setzt sich für verbindliche Rahmenbedingungen zur Kreislaufwirtschaft ein. Er fordert von der Politik mehr Tempo und Verlässlichkeit – nicht nur bei Matratzen.
Von Martin Auerbach
Über sechs Millionen gebrauchte Matratzen entsorgen Privathaushalte in Deutschland jedes Jahr – 95 Prozent der enthaltenen Materialien werden bis dato verbrannt, das sind über 85.500 Tonnen Wertstoffe, die ungenutzt verloren gehen. Unsere Nachbarländer Belgien, Frankreich und Niederlande zeigen mit funktionierenden Systemen der Erweiterten Herstellerverantwortung für Matratzen (Extended Producer Responsibility, kurz EPR): Das muss nicht sein! Die drei Länder verfügen über funktionierende Rückwärtslogistik für Matratzen, wenden Downcycling- und Recyclingverfahren auf die so gewonnenen Materialien an und bauen ihre Kapazitäten weiter aus. Die Finanzierung erfolgt durch Gebühren, die von den Inverkehrbringern pro Matratze zu entrichten sind.
Der Aufbau eines industriegetragenen EPR-Systems für Matratzen ist die entscheidende Maßnahme, um auch in Deutschland diesen wertvollen Stoffstrom zu nutzen und zur Kreislaufwirtschaft beizutragen. Deshalb lautet der eindringliche Appell des Matratzenverbands an die neue Bundesregierung: Schaffen Sie den regulatorischen Rahmen und fördern Sie die Umsetzung eines EPR-Systems in Deutschland, damit wir in der Entwicklung nicht noch weiter hinter unsere Nachbarländer zurückfallen!
Der Fachverband Matratzen-Industrie will nicht warten, bis die Veränderungen von der Politik top-down bei den Unternehmen ankommen. Nicht wenigen Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals, weitere Hängepartien sind nicht hinnehmbar. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Branchen – und das gilt natürlich nicht nur für Matratzen – jetzt ihre Möglichkeiten nutzen, mitzugestalten und Fakten zu schaffen. Wir wollen die Prozesse beschleunigen und vor allem den Wandel so mitgestalten, dass unsere Wirtschaft gestärkt wird. Landläufig mag es das Vorurteil geben, wonach die Industrie der Haupt-Bremser für den grünen Wandel sei und sich nur dann bewege, wenn sie dazu gezwungen wird. Doch das entspricht – zumindest für unsere Branche – nicht der Realität.
Der Matratzenverband bearbeitet das Mega-Thema Transformation schon seit Jahren mit Engagement. Nach einem Positionspapier zur Matratzen-EPR 2022 und einem Real-Labor zur Getrenntsammlung und Zerlegung von Alt-Matratzen 2023 folgte Ende letzten Jahres die Gründung der Betreiber-Organisation Matratzen Recycling Deutschland (MRD, www.matratzen-recycling.de). So übernimmt der Verband gemeinsam mit zehn seiner Mitgliedsunternehmen eine Vorreiterrolle.
Um den Status quo besser einzuordnen, an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur regulatorischen Arbeit auf EU- und Bundesebene: „Nachhaltige Produkte zur Norm in Europa machen“ – mit diesem Slogan präsentierte die Europäische Kommission im Frühjahr 2022 ihre „Schlüsselmaßnahmen für kreislauffähige und nachhaltige Produkte“. Das Paket ist ein zentraler Baustein des Green Deals und das Ziel ist nicht weniger als die EU-weite Umstellung auf Kreislaufwirtschaft. Die Industrie soll von Anfang an, also ab der Entwicklung und Gestaltung neuer Produkte, verpflichtet werden, umwelt- und kreislauforientiert zu handeln.
Das alles ist heute ziemlich genau drei Jahre her, ein guter Anlass also, um zu hinterfragen, was seitdem passiert ist – oder auch nicht passiert ist – und an welchen Stellen der Prozess stockt. Werfen wir dafür noch mal einen Blick zurück auf die angepeilten Schlüsselmaßnahmen der EU: In deren Mittelpunkt steht die neue Öko-Design-Verordnung (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, kurz ESPR), die auch tatsächlich im Sommer 2024 verabschiedet wurde. Nach und nach werden jetzt für immer mehr Produktgruppen Öko-Design-Kriterien erarbeitet. Neben Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten zählen dazu auch die ressourcen- und energieeffiziente Produktion sowie verpflichtende Rezyklat-Anteile. Zudem müssen bis 2030 sektorübergreifend Digitale Produktpässe (DPP) eingeführt werden.
Mit dem Arbeitspaket von 2022 sollen weiterhin die Vernichtung unverkaufter Produkte verhindert, nachhaltige Geschäftsmodelle gefördert und die Vergabe öffentlicher Aufträge an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt werden. Ein dickes Brett also, das die EU da bohren will. Und davon verspricht sie sich und den beteiligten Stakeholdern neben der „bloßen“ Ressourcen-Schonung einige Zusatznutzen: „Möbel, Textilien und andere Produkte werden zur Widerstandsfähigkeit der EU-Wirtschaft beitragen“, so heißt es in der Veröffentlichung zur EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Den Unternehmen werden sinkende Verwaltungskosten, fairer Wettbewerb und zudem ein weltweiter Wettbewerbsvorteil in Aussicht gestellt. Verbraucher sollen ihre Kaufentscheidungen unkompliziert an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten und sich z. B. für langlebigere Konsumgüter entscheiden können. Alles vielversprechende Perspektiven, denen sich kaum einer verschließen würde – insbesondere in Zeiten, in denen die Wirtschaft unter schwacher Nachfrage und globalem Wettbewerbsdruck leidet. Aber wo stehen wir heute, drei Jahre nach den beschriebenen Absichtserklärungen?
Das Inkrafttreten der ESPR im Juli 2024 markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt, denn sie bringt den Rechtsrahmen für verpflichtende Öko-Design-Anforderungen für nahezu alle Arten von Produkten. Und das ist ein zentraler Aspekt: Nur mit soliden Rahmenbedingungen für den Wandel wird die Wirtschaft auf die Beine kommen! Die Industrie ist zwingend angewiesen auf Planungssicherheit für die erforderlichen Strategieanpassungen, aber auch für die nötigen Investitionen in neue Produkte, Fertigungsprozesse und Rückwärtslogistik. Nicht zuletzt wird auch ein erheblicher kommunikativer Aufwand mit breit angelegten Kommunikationskampagnen seitens der Politik nötig sein, um die Konsumentenseite beim Wandel mitzunehmen und zu sensibilisieren – eine Aufgabe, die kaum von der Industrie allein zu stemmen sein wird.
Jetzt Artikel freischalten:
- ✓ Zugang zu allen Artikeln auf INSIDE Wohnen
- ✓ INSIDE als E-Paper lesen
- ✓ Monatlich kündbar