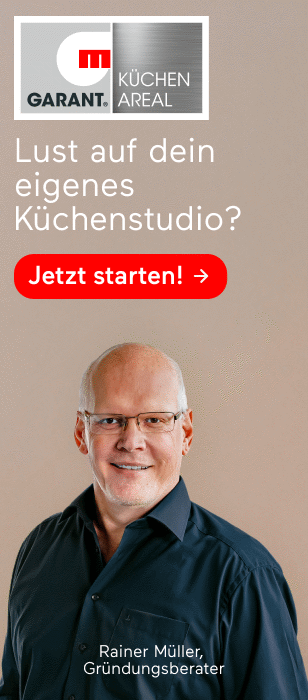Das kommt auf die Branche zu
European Green Deal und die Möbelwelt

In den letzten Jahren hatte man das Gefühl, dass die Taktung, in der der Gesetzgeber neue Vorschriften macht, zugenommen hat. Nachhaltig sollen die Produkte sein, möglichst ressourcenschonend produziert, wiederverwendbar, recycel- und reparierbar. Außerdem muss alles dokumentiert sein. Erst seit Anfang 2023 gilt außerdem das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), für das die betroffenen Unternehmen nun ebenfalls Nachweise führen und dazu vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auch kontrolliert werden. Für viele der deutschen Mittelstandsbetriebe der Möbelbranche ist das keine kleine Herausforderung, zumal nicht wenige ohnehin unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu leiden haben oder schlicht ums Überleben kämpfen. Aber es führt kein Weg dran vorbei: Die neuen Standards ziehen ein, auch wenn diese sich derzeit nur in groben Linien nachzeichnen lassen – der viel zitierte Green Deal.
Beim Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) setzt man sich schon seit Längerem mit dem Thema Circular Economy auseinander. Die Möbelindustrie möchte sogar möglichst zu den ersten Branchen gehören, für die der Deal umgesetzt wird. Heiner Strack, Leiter Technik − Umwelt – Normung beim VDM, und VDM-Geschäftsführer Jan Kurth beschäftigen sich in EFIC-Arbeitsgruppen regelmäßig intensiv mit den entsprechenden EU-Gesetzesinitiativen. Im Entwurf zur Ökodesign-Richtlinie ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) wird festgelegt, wie die Produkte künftig gestaltet werden müssen. Stichworte sind hier unter anderem Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, Energieeffizienz, Wiederaufbereitung und Recycling von Produkten. Die konkreten Anforderungen für einzelne Produktgruppen werden dann als sogenannte delegierte Rechtsakte (Delegated Act) verabschiedet werden.
INSIDE: Herr Kurth, Herr Strack: Wann geht es los? Ab welchem Datum müssen die deutschen Möbelhersteller die neuen Regeln aus Brüssel denn umsetzen?
Heiner Strack: Generell arbeitet die Kommission auf eine Verordnung hin. Die muss dann nicht mehr in nationales Recht überführt werden. Das ist also der schnellstmögliche Weg zum Ziel. Wann die Möbelindustrie sich danach richten muss, hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie bereits zu den Branchen gehören wird, die zu den priorisierten Produktgruppen zählen werden, mit denen begonnen wird. Diese Produktgruppen fasst die EU-Kommission in Arbeitspaketen (den Batches) zusammen. Der Fahrplan der EU sieht für dieses Jahr vor, erste Studien im Batch-I durchzuführen, die ein bis zwei Jahre dauern sollen. Damit würde es ab etwa 2024 einen ersten Entwurf geben. Ab 2026 könnte ein solcher „Delegated Act“ angenommen werden. Mit einer Übergangszeit von ein bis anderthalb Jahren würden die Regeln dann also wohl ab etwa 2027 bindend.
Das wäre dann in etwa fünf Jahren. Bis dahin ist es nicht mehr lang hin.
H.S.: Aktuell wissen wir noch nicht, ob Möbel im ersten Schritt dabei sein werden. Falls nicht, würde sich der obige Fahrplan wohl um vielleicht zwei weitere Jahre nach hinten verschieben. Allerdings: Wir warten nicht ab, sondern begleiten den Prozess proaktiv. Wir ermutigen die Firmen, sich da schon jetzt auf den Weg zu begeben.
Jan Kurth: Im vergangenen Jahr haben wir unsere Gremien und Kreise informiert. Da haben wir so gut wie jede interne Veranstaltung genutzt, um die Firmen darauf hinzuweisen: Das sind die Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen werden. Salopp formuliert haben wir den Firmen gesagt: Bereitet euch vor! Nicht warten, bis etwas Gesetzeskraft erlangt hat, sondern möglichst früh einsteigen. Nach meiner Einschätzung investieren die Unternehmen zunehmend Kraft und Intensität in das Thema. Außerdem kriegen wir mehr Nachfragen nach Detailinfos, sodass wir die Firmen auch ausführlich informieren können. Damit die Branche erkennt, da ist noch was zu tun. Im Zweifel gibt es aber auch ein paar Chancen in der Entwicklung. Und wenn wir früh dabei sind, können wir das als Branche oder Unternehmen nutzen.
Ziehen da alle an einem Strang?
J.K.: Natürlich gibt es die Schnellen und die nicht ganz so Schnellen. Das ist aber bei jedem Prozess so. Pandemie, Lieferkettenproblematik und Krieg haben die Firmen in den vergangenen drei Jahren natürlich stark gefordert. Nicht alle sind deswegen vorne mit dabei, mancher wartet etwas ab. Aber Unternehmen, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, das erleben wir eigentlich nicht. Es ist mittlerweile beim buchstäblich letzten Unternehmen angekommen, dass der Green Deal ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss.
Und welche Chancen gibt es für die besonders Schnellen?
J.K.: Das ist letztlich wie bei jedem Produktangebot. Je schneller man ist, um so größere Marktchancen ergeben sich. Nehmen wir das Beispiel Reparierbarkeit: Wenn ich da alle Anforderungen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Zirkularität jetzt schon erfüllen kann, umso besser. Das ist im Markt auch bekannt. Schon allein gegenüber nicht-europäischen Herstellern ist man da dann natürlich im Vorteil.
Also auch ein Instrument, um sich im globalen Markt zu behaupten. Das Ganze scheint ja auch recht bürokratisch zu laufen, auf Seiten des Gesetzgebers. Ist das nicht eine Überforderung, etwa für die kleinen Firmen? Oder täuscht der Eindruck?
J.K.: Natürlich sind Unternehmen, die eine eigene Abteilung dafür haben, im Vorteil gegenüber einem 60-Mann-Betrieb, bei dem der Chef diesen Prozess noch mitsteuern muss. Nach unserer Einschätzung sollten die Anforderungen mittelstandstauglich sein, zumindest müssen sie es sein. Und deswegen sind wir auch intensiv dabei, auch auf europäischer Ebene mitzuarbeiten. Wenn wir da alle auf europäischer Ebene weiter an einem Strang ziehen, erreichen wir eine Lösung für alle im Markt. Als deutsche Möbelindustrie sind wir im europäischen Vergleich noch etwas größer strukturiert als etwa unsere Kollegen in Italien.
H.S.: Bei den Mitgliedsunternehmen ist das im Zweifel dickere Brett, das zu bohren ist, der Austausch von Daten. Da sind die Branche und deren IT-Landschaften noch recht heterogen unterwegs. Und Daten sind auch ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Der digitale Produktpass (DPP) wird kommen und ebenfalls ein Element im Green-Deal-Paket sein. Unser Votum Richtung EU-Kommission ist aber so, dass die überwiegende Anzahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen die Regeln umsetzen können muss. Auch in Ländern wie Schweden sind viel mehr kleine Firmen unterwegs als hier. Auf alle wollen wir Rücksicht nehmen. Es darf keine Großkonzern-Lösung geben, die die anderen übergestülpt bekommen. Es wird allerdings am Ende des Tages für alle eine Herausforderung werden.
Das erfordert gute Abstimmungen und häufige Treffen mit dem europäischen Möbelindustrieverband EFIC.
H.S.: Bei EFIC haben wir eine Circular-Economy-Arbeitsgruppe, in der wir uns virtuell oder persönlich mindestens alle vier Wochen treffen. Manchmal ist die Taktung der Meetings kürzer, je nach Bedarf. Über Positionspapiere und andere Maßnahmen begleiten wir den Rechtssetzungsprozess vom Anfang bis zum Schluss.
J.K.: Auf europäischer Ebene ist es deshalb so wichtig, am Ball zu bleiben, damit die Kommission überhaupt weiß, wer ihre Ansprechpartner sind und dass es eine gemeinsame Position gibt. Ein großer Konzern wie Ikea hat eine eigene Stabsabteilung für die Lobbyarbeit, um die Themen voranzutreiben. Und Ikea ist – als einziges Unternehmen direkt – auch Mitglied bei EFIC. Selbstverständlich muss man sich in den Gremien deshalb gut absprechen. Aber wir möchten natürlich nachher keine reinen Ikea-Circular-Economy-Regeln haben, nach denen sich alle richten sollen. Im EFIC-Konsortium müssen wir uns deshalb genau abstimmen, damit es adaptierbar für alle ist.
H.S.: Wir liegen da auch nicht weit von Ikea entfernt. Ikea hat ähnliche Interessen. Schließlich setzt auch Ikea auf kleine und mittelständische Unternehmen als Lieferanten.
Gibt es für den Premium- und den Preiseinstiegsbereich unterschiedliche Ansätze bei der Zirkularwirtschaft?
J.K.: Die Grundanforderungen sind für alle gleich. Es ist eher eine Frage, wie organisiere und strukturiere ich Vorprodukte und Themen.
H.S.: Am Ende entscheiden natürlich die Konsumenten beim Kauf. Und es wird sicher eine Übergangsphase geben, wo auch nicht-nachhaltige Lösungen weiter ihre Bedeutung haben. Aber ich bin sicher, dass letztlich nur nachhaltige Produkte am Markt verbleiben werden. Langfristig werden nur nachhaltige Firmen und Produkte überleben.
Kommuniziert die Politik denn ausreichend gut?
J.K.: Die Politik könnte noch besser darin werden, die unterschiedlichen Initiativen auf den unterschiedlichen Ebenen wie national und europäisch besser miteinander abzustimmen. Mit dem neuen Koalitionsvertrag kamen Dinge wie das Recht auf Reparierbarkeit hinzu, die aber auf europäischer Ebene schon in Arbeit sind. Man darf nicht dem typisch deutschen Reflex nachgeben nach dem Motto: „Wir wollen es feinziselierter und schneller besser machen als alle anderen”. Wichtig ist, dass man eine saubere, einheitliche europäische Vorgabe hat und diese im Falle einer Richtlinie entsprechend in nationales Recht überführt wird. Und, zweiter Punkt, dass man nicht nur darauf schaut, wie die Hersteller in der EU reagieren. Denn es bringt wenig, wenn die europäischen Hersteller alles erfüllen, aber man bei einer Importquote – wie bei uns von 60 Prozent – nicht überwacht und kontrolliert, was eingeführt wird.
Kann da noch nachgearbeitet werden?
J.K.: Es muss, nach meiner Meinung. Die Marktüberwachung ist leider komplett schlecht aufgestellt. Kontrollen gab es immer nur in Bereichen, die gerade im Fokus standen, etwa bei elektronischen Geräten. Besonders ein Produktfeld wie Möbel gehört da bislang gar nicht dazu. Wir brauchen dann also auch eine ganz andere Aufstellung in der Marktüberwachung.
Wie weit ist Deutschland bei der Kreislaufwirtschaft? Bei der von der Kommission errechneten Circular Material Use Rate, die angibt, wie viel recyceltes Material die Industrie jeweils verwendet, liegt der Wert in den Niederlanden bei fast einem Drittel, hierzulande aber nur bei 13 Prozent.
J.K.: Das muss man sicher auch produkt- oder anwendungsspezifisch betrachten. Ein Beispiel: Beim Thema Altpapier sind wir gut aufgestellt, generell bei Sekundärrohstoffen. Aber bei der Möbelindustrie und dem verwendeten Hauptwerkstoff Holz ist das mehr als ausbaufähig. Beim Sperrmüll beispielsweise, da wird das Holz mit allem anderen zwar gesammelt – aber dann verbrannt. Aus diesem vermischten Zeugs kann man gar nichts mehr machen. Mit Recycling und stofflicher Holz-Wiederverwendung hat das nichts zu tun. Da ist noch Luft nach oben.
H.S.: Da kann die Politik Vorgaben machen: Stoffliche vor thermischer Nutzung, Stichwort Kaskadeneffekt. Das sind politische Rahmensetzungen, wo noch etwas getan werden muss. Genau wie beim Abfallbegriff. Abfälle bringt der Entsorger zur Verwertung weg. Was landet da? Holz und Kunststoff. Das, was wir für Holz fordern, das wollen auch die Kunststoffe nutzenden Industrien: „Wir wollen das Material zurück.“ Möglichst frühe Trennung von Stoffen, das ist immens wichtig. Auch da wird sich künftig noch einiges verbessern müssen. Gerade beim Kunststoff sieht man, dass das derzeit vielfach Downcycling ist: Aus hochwertigen Kunststoffen werden dann noch höchstens PET-Flaschen. Das Ziel muss für alle Materialien sein, über eine gut organisierte Reverse-Logistik mit einer frühestmöglichen, sauberen Materialtrennung für hochwertige Rezyklate zu sorgen, die dann in Produkte gleicher oder besserer Wertigkeit eingesetzt werden können.
Gibt es bei Holz oder Kunststoff auch eine Allianz mit anderen aus dem Markt?
J.K.: Wir haben im Verband und mit unseren Partnern ein Cluster gegründet: Holzwerkstoffindustrie, Hersteller und Handel kooperieren dort. Schließlich sitzen wir da ja auch in einem Boot, es ist unser gemeinsames Interesse. Mit allen Akteuren schauen wir, dass wir eine skalierbare Branchenlösung entwerfen, die dann in einem regionalen Pilotprojekt mit der Branche und den Entsorgern getestet werden könnte.
Wann könnte das so weit sein?
J.K.: Die Gespräche dazu laufen schon. Aber in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr so weit kommen.
Ist das vorgegebene Tempo für den Green Deal zu schnell? Oder bleibt ausreichend Zeit?
H.S.: Der Zeitplan ist das eine, aber auch: In welchen Schritten gehe ich voran. Wir werden stufenweise dahinkommen müssen, iterativ, und berücksichtigen, dass alle mitmachen können. Zumindest in einigen Dingen wie z.B. dem Werkstoff Holz und der Qualität der Möbel haben wir als deutsche Möbelindustrie eine gute Basis. Ansonsten heißt es, wie bereits von Jan Kurth erwähnt: loslaufen und nicht abwarten.
Login
Post von INSIDE
Schlagzeilen, News und manchmal mehr in fünf Minuten
Mal morgens, mal abends in Ihrem Postfach