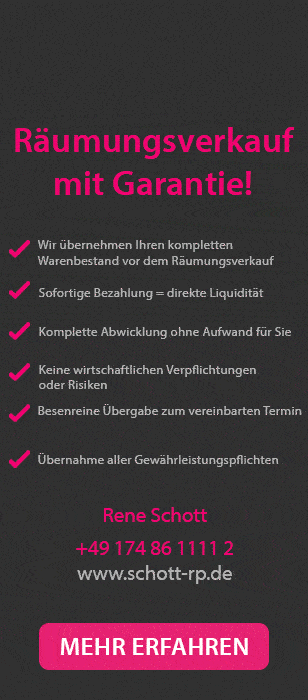Flexibler agieren
Krisenmanagement in der Zulieferindustrie

Die Branche rüstet sich für die kommenden Monate. Die Volumina müssen runter, Flexibilisierung ist das Zauberwort der Stunde. Ein Rundruf durch die Zulieferindustrie. Dieter Rezbach hat gerade viel zu tun.
Stammkunden haben Fragen an ihn: Hersteller aus allen Bereichen der Holz- und Möbelbranche, Spielzeughersteller, ja sogar ein Musikinstrumentenbauer. Vom Milliarden-Konzern bis zum kleinen Spezialisten reicht die Palette. Die Outsider erwischen Rezbach zum Videocall beim Frühstück in Dubai. Die Lage draußen ist schwierig, in der Industrie haben viele große Fragezeichen auf der Stirn. Wie kommen wir durch die nächsten Monate? Ohne Entlassungen? Wie kommen wir mit diesen Volumina und Forecasts zurecht? Wir haben Fragen zur Lage in der Industrie, zu Flexibilisierung und Kostenmanagement in der Produktion, bevor Rezbach nachher zum Kunden fährt. Ein großer Immobilienentwickler in Dubai. Rezbach ist eine ganze Woche dort. Der Kunde hat Großes vor – auch eine Folge von Lieferkettenproblemen und den Veränderungen im Markt.
Vor knapp 20 Jahren hat Rezbach Lignum Consulting mit Sitz in Kupferzell gegründet. Rezbach hat einst eine Schreinerlehre gemacht, dann ging‘s nach Rosenheim zum Studium. Er fing in einem Ingenieurbüro an und machte dort Karriere. 2002 kündigte Rezbach und gründete 2003 Lignum Consulting mit Fokus auf die Holz- und Möbelindustrie. Dort sind heute viele Holztechnik-Ingenieure im Team und arbeiten zusammen mit ihren Kunden an Lösungen für die komplexen produktionstechnischen Herausforderungen dieser Zeit. Rezbach hat einen breiten Horizont, viel Erfahrung. Die 30-Mann-Truppe aus Kupferzell hat bislang über 400 Kunden aus der internationalen Holz- und Möbelbranche beraten. Die Berater sind viel unterwegs: 75 Prozent der Mandate werden im DACH-Raum erledigt. Auch weltweit analysieren die Lignum-Leute die Lage für ihre Kunden. In Nord- und Südamerika gibt es eigene Standorte.
„Die Aussichten auf das nächste Jahr sind für viele Firmen schon sehr beunruhigend. Keiner weiß genau, was auf ihn zukommt. Die Auftragseingänge der letzten Wochen und Monate und die Forecasts setzen viele unter Druck. Der Handlungsdruck ist groß“, sagt der 60-Jährige. In der Branche steuern viele seit Wochen und Monaten dagegen. Zwar haben im Mai, Juni die Ersten wie Ikea ihre Prognosen schon drastisch nach unten geschraubt. Andere haben über den Sommer hingegen aber noch voll produziert, Rückstände nachgeholt und die Läger vollgemacht. Man wollte gerüstet sein. Dann kam das große Sommerloch. Und im Herbst kam bislang kein klassisches Herbstgeschäft. Der September war vielerorts eine Katastrophe. Im Oktober geht es nun einigermaßen, teils besser als befürchtet. Je nach Segment. Doch über allem steht die Sorge vor einem historisch schlechten ersten Halbjahr 2023.
Klar sei, sagt Rezbach: Lange erlernte und gelebte Methoden, etwa aus der Lean Production, müssen nun dringend angepasst werden. Rezbach: „Nach der reinen Lehre des Fließprinzips waren eigene Lagerbestände ja böse. Alles sollte fließen. Seit Corona gibt es da ein Umdenken. Aus naheliegenden Gründen.“ Hersteller haben sich ihre Läger, sofern vorhanden, dann wieder vollgeknallt. Die eigene Lieferfähigkeit hatte und hat oberste Priorität in Zeiten gestörter Lieferketten. „Unser Ziel war durch die gesamte Corona-Zeit bis heute, die Lieferfähigkeit zu sichern und ein guter und verlässlicher Partner zu sein“, sagt zum Beispiel Alexander Abke, Geschäftsführer des Leuchtenspezialisten Hera. Bei dem einen gelang das besser, beim anderen schlechter. Hera etwa war immer am Start, hat dafür aber auch viel getan. Hera hat die eigene Lieferkette immer im Griff, ist eher bei den höherwertigen Küchenherstellern engagiert. Im Vertriebssegment Ladenbau sorgt man für Aufträge, indem man auch mit den Kunden mitwandert. Die Fertigung in diesem Segment hat sich zuletzt stark nach Osteuropa verlagert. Hera versucht jetzt eben dort, die Ladenbau-Objekte zu gewinnen. Weniger Großprojekte, jetzt eher Einzelprojekte, sagt Abke. Man müsse flexibel sein.
Wenn nichts mehr fließt
Zurück zur fließenden Produktion: Ein Rezbach-Kunde aus dem Caravan-Markt hatte vor Corona stark auf just in time in der eigenen Lieferkette umgestellt. Alles floss. Dann kamen keine Fahrzeuge der Automobilhersteller mehr. Es fehlt an Bauteilen, vor allem Elektronikkomponenten. Nun steht die Produktion häufig trotz bester Auftragslage. Das Problem kennen alle aus den vergangenen Corona-Jahren. Und jetzt? Die Läger sind voll. Doch es fließt zu wenig ab. Eine angepasste und deutlich flexibler aufgestellte Lieferkette, der Abbau von Stundenkonten, weniger Leiharbeiter gehören heute zu den häufigsten und am schnellsten wirksamen Instrumenten der Anpassung. Liefersicherheit sei wichtig, der Auf- und Ausbau regionaler Lieferketten zudem immer wichtiger, sagt Rezbach. „Ein oder mehrere Zulieferer direkt vor Ort, das hat entscheidende Vorteile.“ Ein weltweiter Trend, der auch mit Rezbachs aktuellem Projekt am Golf zu tun hat. Dort will der besagte Immobilienentwickler sich unabhängiger machen von seinen vielen Zulieferern – er will jetzt eine eigene Fabrik hochziehen.
Ikea fuhr Bestellungen bei verschiedenen Artikeln bereits im Juni um 20 bis knapp 30 Prozent herunter. Hohe oder steigende Materialpreise und vor allem die schwer zu kalkulierenden Preiserhöhungen bei Strom und Erdgas, die der irgendwann kommende Gaspreisdeckel wohl nicht abfedern wird, machen der Branche zu schaffen. Die Holzwerkstoffindustrie stellt in verschiedenen Werken bereits wochenweise ab, zieht Wartungsarbeiten vor. Ewigkeitslieferzeiten für Spanplatten und MDF, die noch im ersten Halbjahr so manchen Abnehmer zur Verzweiflung brachten, sind passé. Auch einige Beschlaggrößen haben teilweise zweistellige AE-Rückgänge zu verkraften. Im Bereich Wohnen laufen oft bis zu 30 Prozent Minus auf. Dazu kommen teilweise gewisse Überreaktionen im Bestellverhalten der Kunden, die einerseits auf den Herbstmessen nach außen die Stimmung hochhielten, hintenraus aber drastisch ihre Bestellmengen kappten und schon auf Kurzarbeit schalteten. In der Zulieferindustrie hat man das schräge Treiben teilweise nicht mehr ganz nachvollziehen können.
Denn in der Vorlieferindustrie ist der Druck schon länger zu spüren. Allen gemein ist: Entlassungen sollen verhindert werden. Das mühsam in der Boomphase aufgebaute Personal, man will es jetzt nicht verlieren. „Irgendwann geht es wieder los, dann wollen wir da sein, das ist doch klar“, sagt Blum-Deutschland-Geschäftsführer André Dorner. In den vergangenen zwei Jahren sind viele Menschen und Maschinen in der Zulieferindustrie am oberen Limit des Machbaren gefahren, teilweise oft darüber hinaus. Auf einen Schlag ist das Geschäft dann abgerissen. „Die Dynamik ist es am Ende auch, die vielen und auch uns zusetzt“, sagt Hettich-Geschäftsführer Uwe Kreidel. Viele haben in bestimmten Produktionsbereichen Kurzarbeit angemeldet. In anderen läuft es auf dem Niveau von 2019 ganz ordentlich.
Ein Kunststoffspezialist wie Agoform plant, seine Extrusionsmaschinen, die viel Strom brauchen („Die ganze Debatte ging uns immer zu stark nur um Gas, der steigende Strompreis war lange kein Thema“, sagt Agoform-Geschäftsführer Michael Ruprecht), wenn es härter wird, nur noch drei oder vier Tage laufen zu lassen. Sie müssen durchlaufen, dann aber eben nur die halbe Woche. Grass meldete Anfang Oktober einen „deutlichen Rückgang“ der Bestellungen aus dem Handwerk. Im Geschäftsbereich Industrie, der vor allem große Möbel- und Küchenhersteller beliefert, verlaufe alles konstant, heißt es. Grass gehe „verhalten optimistisch in das kommende Jahr.“ Auch Kesseböhmer hat ab August einen signifikanten zweistelligen Einbruch des Auftragseingangs festgestellt, und zwar vor allem im Export, was auch daran liegen könnte, dass dort mit lagerhaltenden Händlern zusammengearbeitet wird, die nun die Bestände runterfahren. Geschäftsführer Burkhard Schreiber: „Wir selbst haben die Läger voll mit Materialien aufgrund früherer Forecasts, was eine enorme Kapitalbindung bedeutet. Die Prognose mussten wir für dieses Jahr nach unten korrigieren und planen auch für 2023 mit einem Minus beim Volumen.“ Aktuell stellen sie in Bad Essen-Dahlinghausen von Drei- auf Zweischichtbetrieb um, wenn auch nicht in allen Bereichen, und passen die Personalstruktur an. Leiharbeit wird auf null zurückgefahren.
Beim zu Surteco gehörenden Kantenhersteller Kröning werden die Kapazitäten so an den rückläufigen AE angepasst: Zunächst wurde einige Wochen lang die Produktion an einem Tag ausgesetzt, ansonsten aber weiter dreischichtig gearbeitet und auch vorproduziert. In der Kalenderwoche 40 wurden Herstellung und Versand komplett ausgesetzt, lediglich die Verwaltung war normal im Dienst. Kröning-Vertriebsleiter Michael Recke: „Nun werden wir mal sehen, was die nächsten Wochen bringen. Zuletzt hat sich der Auftragseingang schon wieder ein wenig stabilisiert.“
Die deutsche Küchenmöbelindustrie scheint bislang am wenigsten ihre Kapazitäten herunterzufahren. Noch sind Aufträge da und zwar oft auch bis ins neue Jahr rein. Und dann? Kastenmöbelhersteller und Teile-Lieferanten dagegen spüren geringere Auftragseingänge teilweise deutlich. Auch Ikea-Lieferanten berichten, dass einige Produkte sich deutlich langsamer drehten. Vivonio-CEO Elmar Duffner, der mit den Töchtern Staud und Maja in Kasendorf und Wittichenau einen guten Überblick über die Lage hat, sagt: „Am schwersten haben es die Töchter, die stark in die Möbelgroßfläche reinliefern.“
Flexibilisierung kostet
Wenn volle Läger auf sinkende Auftragseingänge treffen: Diesen Clash haben auch die Banken längst im Fokus. Liquidität erhalten wird immer schwieriger. Im viermal jährlich erscheinenden Bank Lending Survey (BLS) der Deutschen Bundesbank zeigte sich das schon im zweiten Quartal. Damals „legte die Kreditnachfrage der Unternehmen erneut zu, vor allem nach kurzfristigen Krediten. Als Grund für den Anstieg führten die Banken nahezu ausschließlich den gestiegenen Mittelbedarf für Lagerhaltung und Betriebsmittel an.“ Instabile Lieferketten und der Krieg in der Ukraine haben demnach die Lagerhaltung vergrößert. „Liquidität wird weiter ein enorm wichtiges Feld für die Unternehmen sein“, sagt Rezbach. Karsten Schulze, Partner der Beratungsfirma FTI Andersch, sieht das so: „Wichtig ist, in Szenarien zu planenmund die Finanzierung im Blick zu behalten. Wo können Risiken entstehen? Wo ist eine Firma verletzbar?“
Auch Flexibilisierungsprojekte sind mit Investitionen verbunden. „Flexibilisierung kostet Geld. Allerdings kann sich diese Investition gut rechnen, wenn man es richtig macht“, sagt Heiko Rauscher. Der Industrie- und Automobilexperte ist Senior Managing Director bei FTI Andersch und kennt auch den chinesischen Markt sehr gut. Rauscher bemerkt eine größere Nachfrage nach Flexibilisierungsprojekten: „Vor Corona gab es das nur in geringerem Umfang. Das ist ganz klar eine Trendumkehr.“ Seit Beginn der Corona-Krise hätten viele Industrieunternehmen begonnen, flexibler zu werden. Der Grund: „In der Pandemie führten zu große Spezialisierung und lange, komplexe Lieferketten dazu, dass viele Aufträge nicht oder stark verspätet abgearbeitet werden konnten. Firmen haben hierdurch viel Geld verloren.“
Der Motor Neubau ist abgewürgt
Eigene Mittel stärken, Geld für die Umstellung freischaufeln: Das ist das eine. Aber große Umsätze folgen daraufhin nicht unbedingt. Denn der Mitte Juli veröffentlichte BLS zeigte auch: Wohnungsbaukredite werden weniger oft beantragt – und immer öfter abgelehnt. Inzwischen haben Deutschlands Banken ihre Ausleihbedingungen für Kapital weiter verschärft. War dann auch Anfang Oktober Thema auf der Immobilienmesse Expo Real in München. Die Immobilienfachleute gehen inzwischen von einem starken Rückgang bei Neubauten aus. Statt 400.000 neuen Wohnungen werden 2022 wohl nur 200.000 gebaut. Lediglich die Modernisierung bei der Energetik oder der Ausstattung mit Licht geben aktuell positive Signale. „Neubauten gehen stark zurück. Der entscheidende Motor für die Küchen- und Möbelindustrie ist stark abgebremst worden“, sagt Rezbach.
Blick nach Westen
In verstärkten und zielgerichteten Exportbemühungen suchen viele eine Lösung. Rezbach: „Wir bemerken gerade eine starke Orientierung nach Westen. Zahlreiche Firmen wollen nun auf den US-Markt, auch dort produzieren. Wir haben viele Anfragen für solche Vorhaben.“ Die Hinwendung zu den Exportmärkten bedeutet auch, dort verstärkt neue Strukturen aufzubauen: für den Vertrieb, eine eigene Produktion, die lokale Lieferkette zu stärken (oder erst zu etablieren). „Unsere Betriebe müssen aber die besonderen Anforderungen aus dem US-Markt umsetzen können, um dauerhaft erfolgreich zu sein“, sagt Rezbach. Küchenmöbelindustrie, Korpusmöbelhersteller und teilweise auch Polstermöbler ziehe es aktuell nochmal stärker in Richtung USA. „Da wollen alle hin.“ Und viele sind ja auch schon dort: Die deutschen Exporte in die USA stiegen in den ersten acht Monaten um 27,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, zeigen die vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Neben dem stärkeren US-Dollar machen Außenhandelsexperten vor allem das US-Konjunkturprogramm dafür verantwortlich, dass sich in den Vereinigten Staaten aktuell noch gut Geld verdienen lässt. In der deutschen Küchenindustrie haben viele Amerika schon lange auf dem Schirm, der eine besser, der andere schlechter (siehe INSIDE Spezial Zulieferindustrie 23: „US-Küchenmarkt: Nicht mehr nur der Truthahn“).
Zurück in den Heimatmarkt: Weniger Komplexität, mehr Standardisierung, damit sei die deutsche Möbelindustrie bislang schon „sehr weit vorne“ dabei, wenn man sich auf der Welt umsieht, sagt Rezbach. Er sieht einen Hebel darin, dass die Hersteller künftig verstärkt prüfen, welche ihrer vielen neuen Modelle überhaupt den Weg in den Handel fänden. „Der Entwicklungszyklus ist einfach zu kurz“, sagt Rezbach. Es sei der absolute Wahnsinn, was hier an Geld, Kraft und Ressourcen verschwendet werde. Auch bei der Digitalisierung hätten viele in der Branche noch Luft nach oben. Rezbach: „Transparente Prozesse und Datenintegration, da gibt es einiges an Potenzial.“
Welche Maßnahmen die Firmen auch ergreifen: Die Umstellung ist weder zum Nulltarif zu haben, noch mal eben so auf die Schnelle vollzogen. Etwa ein bis zwei Jahre dauere es bei vielen Kunden, bis Maßnahmen zur Flexibilisierung greifen, hat man bei FTI Andersch beobachtet. Im Automobilsektor sowie bei Industriegütern gebe es erste Erfolge mit den Konzepten.
Ein besonderes Flexibilisierungsprojekt ist auch Dieter Rezbachs aktueller Job in Dubai. Direkt nach dem Interview muss er los, der Kunde wartet schon auf den Fachmann aus Deutschland. Der große Immobilienentwickler hatte in dem Golf-Emirat ähnliche Probleme wie mancher deutsche Küchenmöbelhersteller während der ersten Welle der Pandemie: Weil Teile fehlten, konnte das Endprodukt nicht an den Mann gebracht werden. Und anstatt sich bei der Ausstattung der Wohnungen wie bislang auf Lieferanten aus dem Ausland zu verlassen, will der Immobilienentwickler nun selbst eine eigene Möbelproduktion in Dubai aufziehen. Wer ist gefragt? Rezbach mit seinem Made-in-Germany-Know-how.